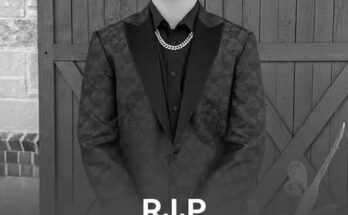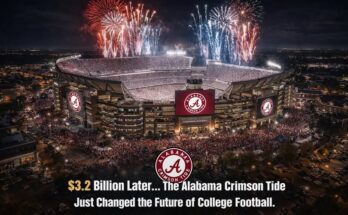Die leeren Plätze im Oberrang Ost, die zwischen 95 und 115 Euro kosten, werfen viele Fragen auf – nicht nur zur Preisgestaltung, sondern auch zu den Erwartungen, der Realität im Stadion und dem allgemeinen Zustand des modernen Fußballs. Warum bleiben Plätze leer, wenn doch ein Spiel ansteht? Warum sind gerade diese Plätze trotz ihrer Lage nicht belegt? Und wie kommt es überhaupt dazu, dass in einem Stadion, das für die Fans gebaut ist, so viele Plätze ungenutzt bleiben, obwohl das Interesse am Fußball scheinbar nie größer war?
Zunächst einmal muss man sich ansehen, wo diese Plätze überhaupt liegen: der Oberrang Ost – in vielen modernen Stadien ist das eine Position, von der man einen sehr guten Überblick über das Spielfeld hat. Man sitzt erhöht, hat keine störenden Hindernisse im Blickfeld, kann die Bewegungen der Spieler klar verfolgen und bekommt eine taktisch interessante Perspektive auf das Spielgeschehen. Eigentlich perfekte Voraussetzungen, um ein Fußballspiel zu genießen. Doch diese theoretischen Vorteile scheinen in der Praxis nicht zu genügen, um die Nachfrage nach diesen Plätzen zu sichern. Warum?
Ein möglicher Grund liegt in der Preisgestaltung. Zwischen 95 und 115 Euro – das ist kein Pappenstiel. Für viele Menschen ist das mehr als ein einfacher Stadionbesuch. Das ist ein Investment. Man muss sich das einmal vorstellen: Für diesen Preis kann man mit einer vierköpfigen Familie locker einen Tagesausflug machen, inklusive Eintritt in einen Freizeitpark oder ein gutes Abendessen. Und hier geht es um einen einzigen Sitzplatz – für nur 90 Minuten Fußball. Die Realität sieht für viele Fans so aus, dass sie sich gut überlegen müssen, wie sie ihr Geld ausgeben. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass viele Spiele live im Fernsehen oder über Streaming-Dienste übertragen werden, fragt man sich zu Recht: Warum überhaupt noch ins Stadion gehen?
Natürlich, es geht um die Atmosphäre. Um das Live-Erlebnis. Das ist etwas, das man nicht durch einen Bildschirm ersetzen kann. Die Geräuschkulisse, die Emotionen, das kollektive Erleben – all das ist Teil des Stadionbesuchs. Aber diese Argumente ziehen nur dann, wenn der Preis in einem vernünftigen Verhältnis dazu steht. Und genau hier liegt das Problem: 95 bis 115 Euro für einen Platz im Oberrang Ost – das empfinden viele als zu teuer. Und nicht nur das: Es ist auch ein Ausdruck einer Entwicklung, bei der sich der Fußball immer weiter von seiner Basis entfernt.
Der Fußball, wie ihn viele über Jahrzehnte geliebt haben, war ein Sport für alle. Ein Ort, an dem sich Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten trafen, um gemeinsam ihre Mannschaft zu unterstützen. Es ging nicht um Exklusivität, sondern um Gemeinschaft. Heute dagegen scheint der Stadionbesuch zunehmend zu einem Luxusgut zu werden. VIP-Logen, Hospitality-Bereiche, Business-Seats – das alles sind Entwicklungen, die zwar aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar sein mögen, aber für viele Fans bedeuten sie vor allem eines: Ausgrenzung. Man ist nicht mehr willkommen, wenn man sich den Eintritt nicht leisten kann oder will.
Und so bleiben die Plätze leer. Nicht, weil niemand Interesse hätte. Sondern weil die Preise eine klare Botschaft senden: Nur wer zahlt, gehört dazu. Das Ergebnis ist eine gespenstische Leere in Bereichen des Stadions, die eigentlich voll sein sollten. Und das wirkt sich nicht nur auf die Stimmung aus, sondern auch auf die Wahrnehmung des Spiels. Leere Ränge senden ein Signal – und es ist kein gutes. Sie stehen für Entfremdung, für falsche Prioritäten, für eine Vermarktungsstrategie, die den eigentlichen Kern des Spiels aus den Augen verloren hat.
Denn was nützt ein perfektes Stadion mit modernster Ausstattung, wenn die Plätze unbesetzt bleiben? Was bringt eine hochkarätige Mannschaft auf dem Rasen, wenn der Funke nicht auf die Ränge überspringt? Es ist paradox: Auf der einen Seite wird so viel investiert, um das Stadionerlebnis möglichst attraktiv zu gestalten – neue Technik, bessere Sichtlinien, komfortablere Sitze. Auf der anderen Seite wird durch die Preisgestaltung genau das verhindert, was den Fußball lebendig macht: die Fans.
Dabei gäbe es Lösungen. Man könnte flexible Preismodelle einführen, die sich an der realen Nachfrage orientieren. Man könnte Restkarten kurz vor dem Spiel zu deutlich reduzierten Preisen anbieten. Oder man könnte bestimmte Kontingente gezielt für junge Fans, Familien oder Geringverdiener reservieren. All das würde helfen, die Plätze zu füllen und gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl im Stadion zu stärken. Aber dazu braucht es den politischen Willen – und den Mut, kurzfristige Gewinne nicht über langfristige Bindung zu stellen.
Die leeren Plätze im Oberrang Ost sind also mehr als nur ein logistisches oder wirtschaftliches Problem. Sie sind ein Symptom für etwas Tieferliegendes. Für eine Entwicklung, bei der der Fußball seine Wurzeln zu verlieren droht. Für eine Kommerzialisierung, die so weit vorangeschritten ist, dass sie ihre eigene Basis untergräbt. Denn irgendwann werden sich die Menschen abwenden. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Frustration. Aus dem Gefühl heraus, dass der Fußball nicht mehr für sie da ist, sondern nur noch für die, die es sich leisten können.
Und das ist gefährlich. Denn der Fußball lebt von der Leidenschaft der Menschen. Von der Treue der Fans. Von der Verbindung zwischen Verein und Anhängern. Wenn diese Verbindung bröckelt, weil sich immer mehr Menschen ausgeschlossen fühlen, dann wird auch das Produkt Fußball leiden. Es wird an Authentizität verlieren, an Glaubwürdigkeit, an Seele. Und das kann auch durch noch so viele Investitionen nicht kompensiert werden.
Man muss sich auch fragen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Warum sind solche Preise heute scheinbar normal? Was hat sich verändert? Ein Teil der Antwort liegt sicher in der globalen Vermarktung des Fußballs. Internationale Fernsehverträge, Sponsoren, Investoren – all das hat den Markt aufgebläht. Die Vereine planen heute mit ganz anderen Summen als noch vor 20 Jahren. Und irgendwoher muss das Geld kommen. Also steigen die Ticketpreise. Es ist eine Kette von Entscheidungen, die am Ende dazu führt, dass sich der einfache Fan seinen Stadionbesuch nicht mehr leisten kann.
Und es ist auch eine Frage der Prioritäten. Manche Vereine investieren Millionen in Spielertransfers, in Marketingkampagnen, in Stadionausbau – aber wenn es um soziale Ticketmodelle geht, wird plötzlich von Wirtschaftlichkeit gesprochen. Das passt nicht zusammen. Es ist eine Frage der Haltung. Wer Fußball für alle will, muss auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Und dazu gehört eben auch, dass die Ticketpreise fair bleiben – oder zumindest nicht abschreckend hoch.
Vielleicht ist es auch eine Chance. Die leeren Plätze im Oberrang Ost könnten ein Weckruf sein. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Dass es nicht reicht, nur auf Einnahmen zu schauen, wenn gleichzeitig das Herzstück des Spiels verloren geht. Es braucht ein Umdenken – bei den Verantwortlichen in den Vereinen, bei den Verbänden, aber auch in der Gesellschaft insgesamt. Fußball ist mehr als ein Geschäft. Er ist ein Kulturgut, ein soziales Phänomen, ein verbindendes Element.
Wenn man sich das nächste Mal ein Spiel anschaut und wieder auf diese leeren Plätze blickt, sollte man nicht nur an den Preis denken. Sondern an das, was dieser leere Platz bedeutet. Er steht für jemanden, der gerne da gewesen wäre – aber nicht konnte. Für jemanden, der sich ausgeschlossen fühlt. Für jemanden, der den Glauben an den Fußball verloren hat. Und genau das sollte nicht sein.
Denn am Ende geht es um die Menschen. Um die, die Woche für Woche ins Stadion kommen, die ihre Stimme verlieren, ihre Fahnen schwenken, ihre Mannschaft tragen. Ohne sie ist der Fußball nichts. Und je eher das wieder ins Bewusstsein rückt, desto besser. Die leeren Plätze sind ein Spiegel der Zeit – aber sie müssen nicht das letzte Wort haben. Es liegt an uns allen, wie es weitergeht.