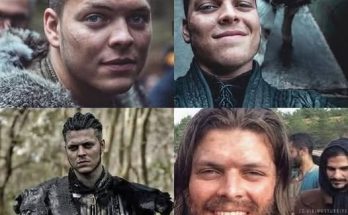Fans fordern, dass eine Statue von Erik ten Hag errichtet wird, um ihn als den besten „verlierenden“ Trainer in der Geschichte des Vereins zu würdigen. Sie schlugen vor, dass die Statue direkt vor dem Stadion aufgestellt wird, am besten in jener Kurve, in der die Fans Woche für Woche mit beeindruckender Ausdauer und Hingabe ihre Mannschaft anfeuern – auch dann, wenn diese sie regelmäßig enttäuscht. Der Vorschlag klingt zunächst wie ein ironischer Kommentar auf die sportliche Misere, doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich dahinter eine faszinierende Mischung aus Resignation, schwarzem Humor und einer eigentümlichen Form der Loyalität, die nur im Fußball existieren kann.
Erik ten Hag, der mit großen Hoffnungen von Ajax Amsterdam geholt wurde, galt einst als der Architekt eines mutigen, dynamischen Fußballstils, der auf Ballbesitz, Pressing und jugendliche Energie setzte. Als er beim Verein anheuerte, war die Erwartung, dass er genau diesen Stil in die Premier League bringt und damit nicht nur Siege, sondern auch die viel zitierte “Identität” zurück nach Old Trafford. Stattdessen lieferte ten Hag eine Saison nach der anderen, in der die Mannschaft zwischen seltsamen taktischen Entscheidungen, verletzungsbedingten Ausfällen und einem chronisch wackeligen Abwehrverhalten hin- und hergeworfen wurde. Die Fans lernten schnell, dass der schöne Fußball wohl nie kommen würde – aber was kam, war noch viel faszinierender: eine Serie von heroischen Niederlagen, unglücklichen Remis und Siegen, die sich eher wie Niederlagen anfühlten.
Der Gedanke an eine Statue für einen Trainer mit einem solchen Track Record mutet zunächst absurd an. Aber genau darin liegt der Reiz. Fußball ist mehr als Zahlen, Tabellenplätze und Titel. Fußball ist Emotion, Drama, Narrativ. Und in diesem Narrativ ist ten Hag kein Verlierer im klassischen Sinne – er ist ein tragischer Held. Ein Mann, der mit einem klaren Plan kam, diesen Plan immer wieder mit Inbrunst verteidigte, und dabei trotz aller Widrigkeiten nie die Fassung verlor. Fans begannen, ihn zu bewundern, nicht für das, was er erreichte, sondern für das, was er versuchte zu erreichen – und dabei spektakulär scheiterte. Er wurde zum Symbol für eine Ära des konstanten Umbruchs, der ewigen “neuen Projekte”, der Hoffnung, die jeden August neu geboren und spätestens im November wieder beerdigt wurde.
In Fanforen kursierten bald erste Entwürfe für die Statue. Eine besonders populäre Variante zeigte ten Hag mit dem Taktikbrett in der Hand, leicht nach vorne gelehnt, der Blick nachdenklich gen Spielfeld gerichtet – als wolle er gerade die nächste bahnbrechende Formation aus dem Nichts erschaffen. Andere Varianten zeigten ihn mit verschränkten Armen, die Stirn in Falten gelegt, während er ein 3:0 gegen einen Aufsteiger analysierte. Die ironische Ehrfurcht, mit der die Fans diese Vorschläge präsentierten, war offensichtlich. Und doch lag in diesen Ideen auch eine Form von echter Zuneigung. Ten Hag war zu einer Projektionsfläche geworden. Für all jene, die wussten, dass Erfolg im modernen Fußball ein Luxus ist – aber dass Hingabe, Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, immer wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist, ebenso bewundernswert sein können.
Der Ruf nach der Statue wurde lauter, als der Verein eine weitere Saison beendete, die in jeder Hinsicht enttäuschend war. Europa League statt Champions League, eine Abwehr, die regelmäßig wie ein Kartenhaus zusammenbrach, und ein Angriff, der so zahnlos war, dass selbst Mittelmaß-Mannschaften sich nicht fürchten mussten. Aber da war auch wieder dieser Moment – ein Last-Minute-Ausgleich gegen einen Top-6-Gegner, ein Elfmeterschießen, das man irgendwie überstand, ein taktischer Schachzug, der für fünf Minuten funktionierte. Es waren diese kleinen Siege inmitten der großen Niederlagen, die Fans dazu brachten, nicht zu verzweifeln, sondern mit sarkastischer Würde zu reagieren.
“Erik, der Unbeirrbare” nannten ihn einige. Andere gingen weiter und schlugen vor, die Statue solle von einer Plakette begleitet werden, auf der sinngemäß steht: „Er kam, sah – und stellte auf Man-Marking um.“ Solche Sätze kursierten in den sozialen Medien, oft begleitet von Montagen, in denen ten Hag als römischer Feldherr dargestellt wurde, der mit Kreide statt Schwert kämpfte und tapfer an der Seitenlinie stand, während um ihn herum das Chaos tobte. Die Statue war längst zu einem Meme geworden – aber zu einem Meme mit Herz.
Ein besonders kreativer Fan organisierte sogar eine Petition, in der die Vereinsführung aufgefordert wurde, nicht nur eine Statue zu errichten, sondern auch ein jährliches Festival zu Ehren ten Hags einzuführen – das „Festival der Erwartung“. Es sollte immer im Juli stattfinden, kurz vor dem Saisonstart, wenn die Hoffnung am größten und die Realität am weitesten entfernt ist. Besucher könnten dann Miniatur-Taktiktafeln bemalen, Haikus über ungenutzte Großchancen schreiben und in einem eigens errichteten Escape Room versuchen, aus einer schlecht strukturierten 4-2-3-1-Formation zu entkommen.
Ein anderer Vorschlag war, die Statue nicht aus Bronze, sondern aus recyceltem Spielmaterial der abgelaufenen Saison zu bauen – alte Trainingshütchen, zerschlissene Tornetze, sogar die Überreste der Transparente mit Parolen wie „In Erik we trust“. Der Vorschlag war so charmant wie undurchführbar, aber das störte niemanden. Die Statue hatte längst eine Bedeutung jenseits des Materiellen angenommen. Sie stand symbolisch für eine Art von Fan-Kultur, die sich weigert, Zynismus das letzte Wort zu überlassen.
Denn was ist ein Fußballverein ohne seine Fans? Und was sind Fans ohne ihren Glauben – sei er auch noch so irrational? In einer Zeit, in der sportlicher Erfolg oft von Millioneninvestitionen, globalen Marketingstrategien und analytisch perfektionierten Spielmodellen abhängt, verkörperte ten Hag etwas anderes. Er war der Mann, der versuchte, Prinzipien hochzuhalten, auch wenn diese Prinzipien regelmäßig gegen die Realität verloren. Er war nicht der Trainer, den der Verein brauchte, und vielleicht auch nicht der, den er verdiente – aber er war der Trainer, den sie bekommen hatten. Und sie machten das Beste daraus.
Die Statue, so schlugen einige vor, solle auch interaktiv sein. Vielleicht mit einem Knopf, den man drücken kann, um einen der typischen ten-Hag-Sätze abzuspielen: „Wir müssen unser Spiel kontrollieren“, „Die Jungs haben alles gegeben“, „Wir lernen aus jeder Situation“. Andere dachten an eine Hologramm-Version, die jeden Montagmorgen vor dem Trainingsgelände erscheint und die Spieler in gewohnter Manier motiviert – auch wenn das Team am Wochenende mit 0:4 untergegangen ist.
Ironie ist ein scharfes Schwert, doch im Fall von ten Hag ist sie nicht verletzend. Sie ist liebevoll, fast schon versöhnlich. Die Statue wäre kein Denkmal des Versagens, sondern eine Würdigung des menschlichen Aspekts im Fußball – des Versuchens, des Irrens, des Weitermachens. In einer Welt, in der nur Titel zählen, wäre sie eine stille Erinnerung daran, dass es auch andere Werte gibt. Dass man auch verlieren kann – und dennoch in Erinnerung bleibt.
Die Vereinsführung hat sich bislang nicht offiziell zu den Vorschlägen geäußert. Man munkelt jedoch, dass einige Funktionäre den Humor der Fans durchaus zu schätzen wissen. Vielleicht wird es keine echte Statue geben, vielleicht bleibt es bei einem popkulturellen Phänomen, das nur in den Köpfen und Herzen der Anhänger existiert. Aber selbst das wäre schon ein Triumph. Denn nicht jeder Trainer, der Trophäen gewinnt, schafft es, so tief im kollektiven Gedächtnis verankert zu werden wie einer, der stets knapp daran vorbeischrammte.
In der Zwischenzeit wird weiter gescherzt, weiter gehofft, weiter gelitten. Und irgendwo, vielleicht in einem kleinen Fanclub in Manchester, modelliert gerade ein Anhänger mit viel Geduld und Knete die erste inoffizielle Erik-ten-Hag-Statue – komplett mit Mini-Taktikbrett und einer Basecap, die er nur selten trug, aber in den Köpfen vieler Fans inzwischen ikonisch ist. Denn so funktioniert Fußballliebe: manchmal irrational, oft frustrierend, aber immer echt. Und wer weiß – vielleicht wird es irgendwann wirklich eine Statue geben. Nicht für den besten Trainer. Sondern für den tapfersten.