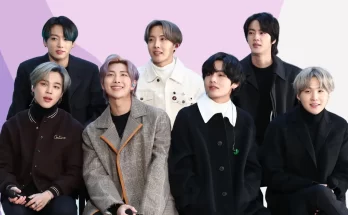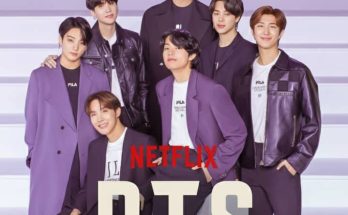Borussia Dortmund steht in der Bundesliga häufig im Rampenlicht – und das meist aus guten Gründen. Spannende Spiele, unbändiger Kampfgeist, leidenschaftliche Fans und mitreißende Stadionatmosphäre gehören seit Jahrzehnten zum Markenzeichen dieses Traditionsvereins. Doch diesmal sorgt eine ganz andere Schlagzeile für Aufsehen: Der BVB belegt in einer überraschenden Statistik tatsächlich den letzten Platz. Ein Umstand, der viele verwundert, einige schockiert und bei manchen sogar Sorgen auslöst. Denn hinter den Zahlen verbirgt sich mehr als nur ein kurioser Zufall – es ist ein Spiegelbild einer Entwicklung, die sich schon seit Monaten andeutet.
Während Borussia Dortmund auf dem Papier weiterhin zu den absoluten Spitzenteams der Bundesliga gehört, zeigen bestimmte Kennzahlen ein anderes Bild. Es ist keine Statistik über Tore, Punkte oder Ballbesitz, sondern eine Kategorie, die viel über Mentalität, Spielstruktur und taktische Balance aussagt. Laut aktuellen Erhebungen ist der BVB in dieser Saison das Team mit den wenigsten gewonnenen Zweikämpfen pro Spiel. Ein Wert, der bei einem Verein, der sich immer über Leidenschaft, Kampf und „Eier in der Hose“ definiert hat, umso überraschender wirkt. Die Fans fragen sich: Wie kann ein Klub mit solch einer Tradition in Sachen Zweikampfstärke plötzlich so schwach dastehen?
Trainer Edin Terzić hatte bereits zu Saisonbeginn betont, dass der BVB nicht nur spielerisch glänzen, sondern auch körperlich und mental zulegen müsse. Doch auf dem Platz scheint sich diese Ansage bislang nur unzureichend durchgesetzt zu haben. In vielen Spielen war zu beobachten, dass Dortmund zwar technisch überlegen agiert, jedoch in entscheidenden Momenten zu passiv oder zögerlich agiert. Besonders in den Duellen gegen robuste Gegner wie Union Berlin, Freiburg oder Augsburg zeigte sich diese Schwäche deutlich: Zweikämpfe gingen verloren, zweite Bälle wurden nicht gesichert, und im Mittelfeld klafften immer wieder Lücken, die die Gegner gnadenlos nutzten. Das Ergebnis sind vermeidbare Gegentore und verschenkte Punkte – eine bittere Realität für einen Klub, der eigentlich um Titel spielen will.
Doch wie konnte es so weit kommen? Experten und ehemalige Profis nennen mehrere Ursachen. Zum einen habe die Mannschaft in den vergangenen Transferperioden zwar technisch versierte Spieler verpflichtet, jedoch zu wenig physisch dominante Akteure. Spieler wie Mats Hummels oder Emre Can verkörpern zwar Erfahrung und Führungsqualität, doch im modernen, schnellen Bundesliga-Fußball reicht das allein nicht aus. Es fehlen Typen wie Axel Witsel oder Jude Bellingham, die nicht nur Bälle eroberten, sondern auch mental eine enorme Präsenz auf dem Platz ausstrahlten. Mit dem Abgang von Bellingham hat der BVB einen Spieler verloren, der in dieser Statistik regelmäßig ganz oben stand – ein Verlust, den man offenbar bis heute nicht kompensieren konnte.
Hinzu kommt die taktische Ausrichtung. Terzić legt großen Wert auf Positionsspiel, Ballzirkulation und geduldigen Spielaufbau. Das führt dazu, dass Dortmund oft in einer abwartenden Haltung agiert und Pressingsituationen meidet, um die defensive Ordnung nicht zu gefährden. Das Resultat: Weniger direkte Zweikämpfe, weniger gewonnene Duelle, weniger Zugriff auf den Gegner. Zwar hat dieses System gegen tief stehende Gegner Vorteile, doch gegen physisch starke Mannschaften wird es schnell zum Problem. Wenn der Gegner aggressiv presst, bleibt Dortmund häufig nur die Flucht in den Rückpass – und genau hier entstehen Unsicherheiten, Ballverluste und letztlich auch Gegentore.
Auch mental scheint die Mannschaft nicht immer bereit, die berühmte „Schlacht im Mittelfeld“ anzunehmen. Ehemalige Spieler wie Patrick Owomoyela und Roman Weidenfeller äußerten sich in Interviews kritisch: „Das ist nicht der BVB, den wir kennen. Früher sind wir rausgegangen, um jeden Ball zu kämpfen. Heute sieht man zu oft, dass man sich auf die Technik verlässt“, sagte Weidenfeller kürzlich. Diese Wahrnehmung teilen auch viele Fans, die in den sozialen Medien ihrem Ärger Luft machen. Für sie steht der BVB seit jeher für bedingungslosen Einsatz – unabhängig vom Ergebnis. Wenn diese Tugenden verloren gehen, verliert der Klub ein Stück seiner Identität.
Doch es wäre zu einfach, die Schuld allein bei den Spielern zu suchen. Auch strukturelle und psychologische Faktoren spielen eine Rolle. Die Mannschaft hat in den letzten Jahren viele Umbrüche erlebt: neue Spieler, wechselnde Kapitäne, eine veränderte Führungsstruktur. Nach dem dramatischen Saisonfinale im Vorjahr, als Dortmund den fast sicheren Meistertitel am letzten Spieltag verspielte, scheint sich ein gewisser mentaler Druck aufgebaut zu haben. Manche Beobachter sprechen von einem „Meisterschaftstrauma“, das unbewusst lähmt. Statt mit Wut und Motivation auf den Platz zu gehen, wirkt die Mannschaft oft verkrampft, beinahe ängstlich. Genau diese Unsicherheit zeigt sich in Zweikampfsituationen: Ein Zögern hier, ein Schritt zu spät dort – und schon ist der Gegner vorbei.
Interessanterweise steht Borussia Dortmund in anderen Kategorien gar nicht so schlecht da. Die Passquote gehört zu den besten der Liga, das Offensivspiel produziert viele Chancen, und auch in Sachen Laufleistung liegt das Team im oberen Drittel. Doch all das nützt wenig, wenn man die Grundtugenden des Fußballs vernachlässigt. In der Bundesliga, wo Körperlichkeit und Einsatzbereitschaft entscheidend sind, kann man technische Eleganz nur dann erfolgreich einsetzen, wenn man die Basisarbeit nicht vernachlässigt. Und genau hier hat Dortmund Nachholbedarf.
Sportdirektor Sebastian Kehl weiß um die Brisanz der Lage. Nach dem jüngsten Spiel äußerte er sich deutlich: „Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir jeden Zweikampf als Chance begreifen. Es reicht nicht, schön zu spielen – wir müssen zeigen, dass wir es mehr wollen als der Gegner.“ Diese Worte zeigen, dass die Verantwortlichen das Problem erkannt haben. Die Frage bleibt nur: Wie schnell lässt sich das ändern? In einer Liga, in der jeder Punkt zählt und der Druck von Woche zu Woche wächst, bleibt dafür kaum Zeit.
Ein möglicher Ansatz liegt in der personellen Anpassung. Junge Spieler wie Salih Özcan, Jamie Bynoe-Gittens oder Felix Nmecha bringen zwar Energie, doch ihnen fehlt noch die Erfahrung, um physisch dominante Gegner konsequent zu bekämpfen. Vielleicht wäre es an der Zeit, wieder mehr auf robuste, zweikampfstarke Spieler zu setzen – Typen, die den Gegnern schon durch ihre Präsenz Respekt einflößen. Auch das Training müsse laut Insidern angepasst werden: mehr Fokus auf Intensität, direkte Duelle und mentale Widerstandsfähigkeit. Früher war genau das die DNA des Vereins: Kampf, Leidenschaft, Widerstand. Attribute, die unter Jürgen Klopp einst die Grundlage für nationale und internationale Erfolge bildeten.
Einige Fans sehen im aktuellen Zustand eine Mahnung, sich wieder auf die Wurzeln zu besinnen. Der „echte Liebe“-Slogan, der Borussia Dortmund weltweit bekannt machte, lebt von Emotionalität und Einsatz. Wenn die Mannschaft diese Werte wieder auf den Platz bringt, könnte sich das Blatt schnell wenden. Denn an Talent mangelt es dem Kader keineswegs. Spieler wie Julian Brandt, Donyell Malen oder Niclas Füllkrug können Spiele im Alleingang entscheiden – vorausgesetzt, sie werden in eine Mannschaft eingebettet, die geschlossen auftritt, sich gegenseitig unterstützt und füreinander kämpft.
Das Signal an die Mannschaft ist klar: Es geht nicht nur um Statistiken oder Tabellenplätze, sondern um Haltung. Die Fans im Signal Iduna Park spüren genau, wann ein Team alles gibt – und wann nicht. Ihr Applaus oder ihre Pfiffe sind oft ehrlicher als jede Analyse. Wenn die Südtribüne schweigt, weiß man, dass etwas nicht stimmt. Und in den letzten Wochen war es genau diese Stille, die vielen zu denken gab. Denn Leidenschaft lässt sich nicht erzwingen, sie muss von innen kommen – aus Überzeugung, Stolz und Willen.
Die kommende Phase der Saison wird daher entscheidend. Der BVB muss beweisen, dass er mehr kann als schöne Spielzüge. Es geht darum, die Kontrolle über das eigene Schicksal zurückzugewinnen. Jeder gewonnene Zweikampf, jeder abgefangene Ball und jeder beherzte Sprint kann die Richtung verändern. Manchmal sind es nicht die spektakulären Tore, sondern die stillen, harten Arbeiten im Hintergrund, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Vielleicht ist diese Statistik, so unangenehm sie auch wirkt, genau der Weckruf, den Dortmund gebraucht hat. Eine Erinnerung daran, dass Erfolg auf Einsatzbereitschaft gründet. Wenn der BVB diesen Weckruf ernst nimmt und sich auf seine Tugenden besinnt, könnte aus einer Schwäche eine neue Stärke entstehen. Denn wer die Fähigkeit besitzt, seine Fehler zu erkennen und daran zu wachsen, der kann gestärkt zurückkommen.
Und vielleicht wird man am Ende der Saison sagen: Diese unscheinbare Statistik, die Borussia Dortmund einst den letzten Platz einbrachte, war der Wendepunkt. Der Moment, an dem der BVB wieder lernte, was es bedeutet, für Schwarz und Gelb zu kämpfen – mit Herz, mit Mut und mit der unbändigen Leidenschaft, die diesen Verein so besonders macht.