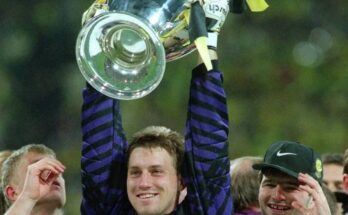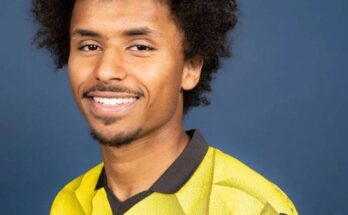Netflix hat eine zutiefst emotionale Dokumentation über die legendären Figuren von Borussia Dortmund veröffentlicht, in der Marco Reus im Mittelpunkt steht – als Symbol unverbrüchlicher Loyalität, selbst nach seinem Abschied. Der Streamingriese rechnet damit, inspirierende 2,5 Millionen Dollar an Spenden zu sammeln, um Projekte zu unterstützen, die der Fußballwelt, der Jugendförderung und vor allem sozialen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zugutekommen sollen. Doch diese Dokumentation ist weit mehr als ein klassisches Porträt eines Fußballers. Sie ist ein filmisches Denkmal, ein Spiegel der Seele eines Vereins und ein emotionales Zeugnis über einen Mann, der über ein Jahrzehnt lang zu einem Synonym für Schwarz-Gelb geworden ist. Und gerade deshalb gelingt Netflix hier ein Werk, das die Menschen erreicht – nicht nur Fans des BVB, sondern jeden, der je erlebt hat, wie Sport zu etwas Größerem wird.
Von der ersten Sekunde an wird klar, dass es sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Sportdoku handelt. Die Kamera öffnet nicht mit einem dramatischen Tor, nicht mit donnerndem Jubel, sondern mit einem stillen Moment: Marco Reus, abseits des Rampenlichts, in einem leeren Stadion, dort, wo er zahllose Spiele entschieden hat. Die Tribünen sind dunkel, nur ein weiches Licht fällt auf den Mittelkreis, und man hört seine Stimme, warm, ruhig, reflektiert. Er spricht über das Gefühl, Teil eines Vereins zu sein, der einen nicht nur als Profi sieht, sondern als Mensch. Über die Verantwortung, die er getragen hat, über die Zweifel, die ihn begleiteten, und über die unzerbrechliche Bindung, die ihn all die Jahre mit Dortmund verband. Dieser Einstieg setzt den Ton für eine Erzählung, die viel tiefer geht als Statistiken, Erfolge oder Rekorde. Es ist die Geschichte eines Kapitäns, der oft verletzt war, oft kritisiert wurde, oft unterschätzt wurde – und der dennoch immer wieder zu seinem Verein zurückkehrte.
Die Dokumentation zeichnet seinen Weg nach, ohne ihn zu glorifizieren. Sie zeigt einen jungen Mann, der in Dortmund zum Helden wurde, aber gleichzeitig seine Verletzungen, seine Rückschläge und die emotionalen Narben offenlegt. Netflix lässt Weggefährten zu Wort kommen: ehemalige Trainer, Teamkollegen, Jugendfreunde, Physiotherapeuten, Mentoren. Doch keiner von ihnen beschreibt Reus als klassischen Superstar. Stattdessen sprechen sie von einem, der die Menschen um ihn herum positiv verändert hat, von einem, der manchmal mehr für andere da war als für sich selbst. In einer Szene erzählt ein ehemaliger Mitspieler, wie Reus kurz nach einer schweren Verletzung ins Trainingszentrum kam – nicht, um selbst zu arbeiten, sondern um den jungen Spielern Mut zu machen. Der Film zeigt, wie Reus sich lächelnd neben sie stellt, zeitweise auf Krücken, und ihnen erklärt, dass jede Hürde im Leben eine Chance sei. Diese Szene wirkt so ehrlich, so echt, dass man kaum glauben kann, wie wenig davon öffentlich wurde.
Besonders eindrucksvoll ist der Teil der Doku, in dem Reus über seinen Abschied spricht. Seine Stimme zittert leicht, die Emotion ist greifbar, aber nie wirkt es inszeniert. Vielmehr ist es ein Abschied, wie man ihn sich von einem Kapitän wünscht: würdevoll, dankbar, tief verbunden. Er spricht davon, dass er nicht gegangen sei, weil er weg wollte, sondern weil es Teil des Fußballkreislaufs sei – ein Kreislauf, in dem man Platz macht für neue Spieler, neue Ideen, neue Generationen. Er betont, wie dankbar er für die Fans ist, die ihn trotz Verletzungen, trotz versäumter Titel und trotz mancher enttäuschenden Saison immer getragen haben. Und Netflix unterstreicht das mit einer Montage, die zu den emotionalsten Momenten gehört, die der deutsche Fußball je filmisch erhalten hat: Szenen von Reus, wie er nach Abpfiffen alleine vor der Südtribüne steht, von Fans, die seinen Namen singen, von Momenten, in denen er mit Tränen in den Augen auf das Meer aus Gelb und Schwarz blickt.
Parallel dazu beleuchtet der Film, warum Netflix mit dieser Dokumentation Spenden sammelt und welche Wirkung sie haben soll. Der Streamingdienst hat angekündigt, mit den erwarteten 2,5 Millionen Dollar nicht etwa eigene Projekte zu finanzieren, sondern gezielt Initiativen zu unterstützen, die Menschen helfen, denen das Leben weniger Glück oder Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ein Großteil der Spenden soll an Jugendförderprogramme gehen, die Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen unterstützen. Netflix betont, dass Reus’ Geschichte vor allem jungen Menschen Mut machen soll, weil sie zeigt, dass man selbst nach Rückschlägen weitergehen und mit Mut und Entschlossenheit seinen eigenen Weg finden kann.
Die Dokumentation zeigt außerdem die tiefen Wurzeln des Vereins in seiner Region. Man sieht Bilder aus Dortmunds Arbeitervierteln, Gespräche mit Fans, mit Menschen, die seit Jahrzehnten ins Stadion gehen, mit jenen, für die der Verein nicht nur ein Hobby, sondern ein Stück Identität ist. Netflix gelingt es, die Bedeutung des BVB für die Stadt in einem Maße festzuhalten, das selbst langjährige Anhänger überrascht. Die Fans sprechen über Reus mit einer Wärme, die selten in dieser Form dokumentiert wurde. Einer sagt: „Er hat uns nie verlassen. Er ist vielleicht nicht mehr auf dem Platz, aber er ist immer noch einer von uns.“ Und diese Aussage wirkt wie ein emotionales Herzstück des Films – denn genau darum geht es: Reus hat Dortmund geprägt, und Dortmund hat Reus geprägt.
Einer der stärksten Momente der Doku zeigt Reus auf einer einfachen Parkbank, an einem Ort seiner Kindheit, wo er oft Fußball gespielt hat. Keine Kameras, keine Sponsoren, kein Stadion. Nur er, ein Ball und der Ort, an dem sein Traum begann. Er spricht darüber, wie wichtig es sei, nie zu vergessen, woher man kommt. Dass Erfolg bedeutungslos wird, wenn man die Verbindung zu seinen Wurzeln verliert. Und in diesem Moment begreift man endgültig, warum Netflix ihn zum Mittelpunkt eines solchen Projekts gemacht hat: weil seine Geschichte eine universelle Botschaft trägt.
Zwischendurch gibt die Dokumentation intime Einblicke in Reus’ Privatleben, ohne voyeuristisch zu werden. Man sieht, wie er Zeit mit seiner Familie verbringt, wie er sich auf alltägliche Dinge konzentriert – kochen, spazieren, lachen. Diese Szenen zeigen einen Mann, der nach all den Jahren im Fußballgeschäft gelernt hat, dass wahres Glück nicht im Rampenlicht liegt, sondern in den Momenten, die man mit den Menschen teilt, die man liebt.
Zum Ende hin kulminiert die gesamte Erzählung in einer letzten Szene, die symbolisch für Reus’ Reise steht. Er betritt noch einmal das leere Stadion, aber diesmal nicht, um zurückzublicken – sondern um nach vorne zu schauen. Der Film endet nicht mit Applaus, nicht mit Jubel, sondern mit einem stillen Moment, in dem Reus in die Kamera sagt: „Man geht nie ganz. Ein Teil von einem bleibt immer da.“ Und genau das ist die Botschaft, die die Dokumentation festhalten möchte – dass Legenden bleiben, selbst wenn ihre aktive Zeit endet.
Netflix hat mit diesem Projekt etwas geschaffen, das weit über Unterhaltung hinausgeht. Die 2,5 Millionen Dollar, die damit voraussichtlich gesammelt werden, sind nur ein Teil des Vermächtnisses. Viel bedeutender ist die Botschaft, die bleibt: dass Loyalität, Menschlichkeit, Mut und die Fähigkeit, trotz Rückschlägen aufzustehen, Werte sind, die den Fußball größer machen als jedes Ergebnis. Und Marco Reus steht in diesem Film als lebender Beweis dafür – als Herz eines Vereins, als Stimme einer Generation, als Mensch, der gezeigt hat, dass wahre Größe auf leisen Wegen entsteht.