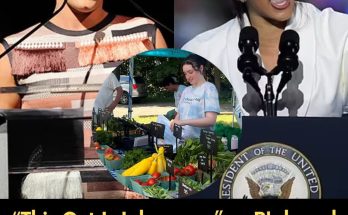Die Meldung, dass ein offizielles Ligaspiel der Bundesliga – konkret zwischen Borussia Dortmund und VfB Stuttgart – erstmals in den USA ausgetragen werden soll, stellt zweifellos einen spektakulären Gedanken dar. Gleichzeitig zeigt sie eindrücklich die Spannung zwischen Globalisierung und Traditionsbewusstsein im deutschen Profifußball und damit auch die grundsätzliche Frage: Wie weit darf Internationalisierung gehen, ohne dass Identität und Wettbewerbsprinzipien Schaden nehmen?
Zunächst einmal muss geklärt werden, ob das Gerücht über ein solches Spiel realistisch ist. Die Ligaleitung der Bundesliga, nämlich die Deutsche Fußball Liga (DFL), hat klar Stellung bezogen: Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Hans‑Joachim Watzke, erklärte, dass solange er das Sagen hat, keine Meisterschafts‑ bzw. Ligaspiele der Bundesliga im Ausland stattfinden werden. Er formulierte es mit den Worten: „As long as I am here in the league responsible, there will be no match abroad, when it comes to competitive matches. Full stop.
Damit ist festzuhalten: Die offizielle Linie lautet derzeit, dass Ligaspiele mit Wettkampfcharakter nicht außerhalb Deutschlands geplant sind. Das heißt aber nicht, dass internationale Freundschafts‑ oder Show‑Matches ausgeschlossen sind – im Gegenteil, diese finden schon statt, um den internationalen Markt zu bedienen. Doch bei einem echten Bundesliga‑Spiel mit Wertung sieht die DFL einen klaren Grenzpunkt.
Warum gibt es überhaupt Überlegungen oder Gerüchte, solche Ligaspiele im Ausland auszutragen? Dafür lassen sich mehrere Gründe anführen: Erstens hat die Bundesliga als Produkt internationale Ausstrahlung – große Vereine wie Dortmund oder Stuttgart haben weltweit Fans, Medieninteresse und Vermarktungspotenzial. Den amerikanischen Markt stärker zu erschließen, gerade vor dem Hintergrund der Fußball‑WM 2026 in den USA (gemeinsam mit Kanada und Mexiko), erscheint attraktiv. Zweitens kann ein Auftritt in den USA als Marken‑ und Werbeplattform dienen, neue Sponsoren, Streaming‑Deals und Aufmerksamkeit gewinnen. Drittens könnte ein solches Event als spektakuläre Geste die Wahrnehmung der Bundesliga im Ausland pushen – etwa in den USA, wo Fußball zwar wächst, aber hinter anderen Sportarten noch zurückliegt.
Doch trotz dieser Vorteile existieren gewichtige Hürden. Das Heim‑ und Auswärtsprinzip ist ein zentrales Element der Bundesliga‑Struktur: Fans kaufen Jahreskarten, identifizieren sich mit ihrem Stadion und ihrem Heimverein; wenn ein Spiel plötzlich in einem fremden Land stattfindet, verliert dieses System an Substanz und das Vertrauen der heimischen Fangemeinschaft könnte schwinden. Dazu kommen logistische und sportliche Faktoren: Reiseaufwand, Zeitverschiebung, Trainingsbedingungen und Infrastruktur sind nicht trivial. Zudem droht die Wahrnehmung, dass sportliche Integrität dem Kommerz weicht – viele Fanverbände warnen vor einer „Kommerzialisierung auf Kosten der Fans“ und einer Verlagerung der Liga weg vom Gemeinschaftscharakter. Diese Sorge wird von Watzke ebenso aufgegriffen, wenn er den Gedanken eines Auslands‑Ligaspiels als „nicht offen zur Interpretation“ bezeichnet.
Ein weiterer Aspekt: Legale und regulatorische Fragen. Die Liga‑Regeln lassen zwar theoretisch die Austragung eines Spiels im Ausland zu (z. B. bei bestimmten Supercup‑Spielen), doch das gilt nicht automatisch für reguläre Ligaspiele mit Punktewertung. Hier müsste eine Änderung der Statuten erfolgen – und es gäbe Proteste von Fans und möglicherweise von Verbänden. Zudem ist die DFL Teil des europäischen Fußballsystems, und bei den großen Verbänden wie UEFA wird eine generelle Verlagerung von Ligaspielen ins Ausland kritisch beurteilt.
Aus Fansicht ist das Thema auch besonders emotional: Viele Anhänger sehen Vereine nicht nur als Marken, sondern als regionale Identitäten mit Tradition, Kultur und sozialer Verankerung. Wird ein Heimspiel ins Ausland verlegt, fühlt sich das oftmals wie ein Verlust – nicht nur logistischer Art, sondern im Sinne eines Grundverständnisses von Fußballvereinen. Auch Vereinsverantwortliche und Imageträger wie der CEO von FC Bayern München, Jan‑Christian Dreesen, äußern sich dazu kritisch: „My position is crystal clear: I think that’s nonsense. The foundation of German football is here in Germany. As such, we shouldn’t turn the Supercup into a purely marketing event…
Somit ergibt sich folgende Sachlage: Ein Spiel wie Dortmund vs. Stuttgart in den USA ist derzeit nicht im Rahmen offizieller Ligaspiele geplant – zumindest nicht mit Wertung und im offiziellen Liga‑Modus. Das heißt nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, aber aktuell widerspricht es der offiziellen Linie der DFL. Es wäre ein bedeutender Schritt, falls so etwas auf den Weg gebracht würde – aber bis dahin bleibt es eher eine Spekulation oder Wunschgedanke als konkrete Planung.
Wenn man versucht, die Debatte etwas weiter zu denken: Es könnte in Zukunft Szenarien geben, in denen die Bundesliga doch Spiele im Ausland zulässt – etwa als Sonderveranstaltung, Showmatch oder Teil eines internationalen „Festivals“, bei dem punktfreie Begegnungen veranstaltet werden. Sollte sich diese Haltung ändern, müsste sie allerdings mit großer Transparenz und Rücksprache mit Vereinen, Fans und Verband erfolgen, um Akzeptanz sicherzustellen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Vertrauen in die Liga‑Regeln, die Heim‑ und Fan‑Traditionen und letztlich auch die Markenidentität der Vereine Schaden nimmt.
Für die beiden beteiligten Vereine – Dortmund und Stuttgart – würde ein solches Spiel immense Chancen bieten: größere internationale Sichtbarkeit, potenziell höhere wirtschaftliche Einnahmen und neue Zielgruppen. Gleichzeitig aber auch Risiken: Verlust des Heimvorteils, Einschränkungen für heimische Fans, logistische Belastung und vielleicht Irritationen bei Sponsoren bzw. Mitgliedern.
Abschließend lässt sich sagen: Die Meldung über ein Topspiel der Bundesliga in den USA ist spannend, sie zeigt die Ambitionen zur Internationalisierung – aber gemessen an den offiziellen Aussagen der DFL aktuell noch nicht Realität. Der deutsche Profifußball befindet sich hier in einem Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Globalisierung. Ob und wann dieses Gleichgewicht sich verschiebt, bleibt offen.