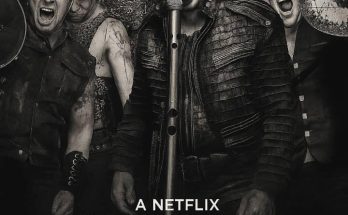Die Geschichte wiederholt sich – in anderer Form, aber mit derselben Wucht, mit der der Fußball seine Kreise schließt. Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit Fabio Capellos AC Mailand mit unerschütterlicher Disziplin, taktischer Raffinesse und einem beinahe maschinenhaften Siegeswillen die europäische Bühne dominierte. Heute ist es der FC Bayern München unter Vincent Kompany, der diesen Geist wieder aufleben lässt – nicht als bloße Kopie vergangener Größe, sondern als moderne Neuinterpretation eines alten Prinzips: Kontrolle, Konsequenz, und der unerschütterliche Glaube daran, dass der nächste Sieg immer der wichtigste ist. Dreizehn Spiele, dreizehn Siege – eine Bilanz, die in ihrer makellosen Klarheit fast schon unwirklich wirkt, und doch ist sie Realität.
Es begann im August, als die Sonne über der Allianz Arena unterging und die neue Bundesliga-Saison eingeläutet wurde. Viele hatten Kompany skeptisch beäugt, als er nach einer durchwachsenen Premier-League-Saison mit Burnley in München anheuerte. Die Frage, ob ein Trainer mit begrenzter Erfahrung auf höchstem Niveau die Wucht des größten deutschen Klubs zähmen könnte, hing in der Luft wie eine leise Drohung. Doch wer Kompanys Spielphilosophie kannte, ahnte früh, dass hier kein Experiment, sondern eine Vision am Werk war. Der Belgier brachte jene Mischung aus taktischer Klarheit, emotionaler Intelligenz und unnachgiebigem Führungswillen mit, die große Trainergenerationen prägt. Und er fand in München einen Kader, der hungrig war – nach einer neuen Identität, nach Wiedergutmachung, nach dem Gefühl, wieder unantastbar zu sein.
Vom ersten Spieltag an war etwas anders. Die Mannschaft wirkte nicht nur gut vorbereitet, sondern geradezu programmiert. Kein hektisches Pressing, kein überhastetes Aufbäumen – stattdessen geduldige Kontrolle, präzises Passspiel, eine Verteidigung, die in den entscheidenden Momenten wie ein einziger Körper agierte. Joshua Kimmich, in neuer Rolle als tiefer Spielmacher, dirigierte das Geschehen mit jener Autorität, die ihn schon lange als Herz des Teams auszeichnet. Jamal Musiala, elegant und unberechenbar, schien in Kompanys System endlich die Freiheit gefunden zu haben, die ihm in früheren Jahren oft gefehlt hatte. Und vorne, wo in der Vergangenheit zu oft von der Abhängigkeit von einzelnen Torjägern gesprochen wurde, rotierte Kompany mit chirurgischer Präzision. Mal Kane, mal Tel, mal Sané in der falschen Neun – die Gegner wussten nie, woher der Schlag kommen würde, nur, dass er unweigerlich kommen würde.
Das Besondere an dieser Siegesserie war nicht nur das Resultat, sondern die Art, wie sie zustande kam. Kein Spiel glich dem anderen, doch alle trugen die gleiche Handschrift. Gegen Union Berlin ein kontrolliertes 2:0, gegen Leverkusen ein taktischer Lehrfilm, gegen Dortmund ein Machtdemonstration, die das Land erschütterte. In jedem Spiel war zu spüren, dass Kompany den Rhythmus seiner Mannschaft fand wie ein Dirigent, der die leisesten Zwischentöne hört. Er forderte Mut in engen Räumen, Präzision in Umschaltmomenten und ein fast asketisches Verhältnis zum Ballverlust. Bayern spielte wieder wie eine Mannschaft, die nicht nur gewinnen, sondern überzeugen wollte.
Doch während die Siege sich summierten, wuchs auch die Erwartung. Dreizehn Siege in Folge – das klang nach Statistik, nach Zahlenmagie, nach Geschichte in Echtzeit. Die Medien sprachen vom „Capello-Rekord“, von der „Wiedergeburt der Perfektion“. Aber Kompany selbst ließ sich von solchen Parallelen kaum beeindrucken. In Interviews blieb er ruhig, fast nüchtern. Er sprach davon, dass es im Fußball keine Perfektion gebe, nur ständige Verbesserung. Dass Rekorde von selbst kommen, wenn man den Fokus nicht verliert. Dass seine Spieler „ihren eigenen Rhythmus finden“ müssten. Und doch lag in seiner Körpersprache etwas, das verriet: Er wusste genau, was hier geschah. Er wusste, dass Geschichte nicht geplant werden kann, aber dass sie sich manchmal ergeben muss, wenn alles stimmt – die Idee, die Menschen, der Moment.
Man könnte sagen, Bayern unter Kompany sei weniger eine Mannschaft, sondern eine Bewegung. Es ist die Verschmelzung von Altem und Neuem, von der deutschen Sehnsucht nach Kontrolle und der belgischen Idee vom kreativen Risiko. Seine Bayern sind diszipliniert, aber nicht dogmatisch; modern, aber nicht kalt. Der Ball läuft, aber nie zum Selbstzweck. Jeder Pass, jeder Laufweg, jede Pressingbewegung hat Sinn, Tiefe, Richtung. Der Gegner wird nicht zermürbt, er wird überlistet. Und wenn man den Spielern zuhört, wie sie über ihren Trainer sprechen, merkt man: Diese Mannschaft glaubt. Nicht blind, nicht aus Routine, sondern aus Überzeugung.
Man erinnere sich an jenes Spiel gegen Leipzig im Oktober, als Bayern nach einer hektischen ersten Halbzeit zurücklag. Früher hätte man vielleicht Panik erwartet, nervöse Blicke, wild gestikulierende Führungsspieler. Doch Kompany blieb ruhig, sprach mit leiser Stimme in der Kabine, veränderte nur Details – die Positionen von zwei Achtern, das Timing im Gegenpressing. Nach der Pause kam ein anderer FC Bayern auf den Platz. Ein Team, das nicht nur das Spiel drehte, sondern es dominierte, als hätte es nie anders verlaufen können. 4:1 stand es am Ende, und man hatte das Gefühl, Zeuge einer Reifeprüfung geworden zu sein.
Diese Ruhe, diese Beherrschtheit, erinnert an Capellos Milan. Damals, Anfang der 1990er, war der italienische Fußball geprägt von Taktik und Disziplin, vom Streben nach struktureller Perfektion. Capello übernahm ein Team, das von Sacchi revolutioniert, aber auch erschöpft war. Er baute auf, was noch da war, justierte, modernisierte, verdichtete. Das Ergebnis war eine Serie von 13 Siegen in Folge in der Saison 1992/93 – ein Kunstwerk aus Gleichgewicht und Konsequenz. Drei Jahrzehnte später ist es Kompany, der diese Idee in die Neuzeit trägt. Der Unterschied liegt im Tempo, im Raumverständnis, im Pressing – doch das Prinzip ist gleich: Wer die Struktur beherrscht, beherrscht das Spiel.
Interessant ist, dass Kompany nicht aus der Schule der großen deutschen Trainergeneration stammt. Er ist kein Klopp-Schüler, kein Guardiola-Abkömmling, kein Tuchel-Erbe. Er ist, in gewisser Weise, ein Außenseiter. Sein Denken speist sich aus vielen Quellen – Guardiolas Positionsspiel, Martínez’ Pragmatismus, seiner eigenen Erfahrung als Spieler unter Citys strengen Hierarchien. In München hat er all das zusammengeführt. Und was entsteht, ist ein Stil, der die Essenz des modernen Fußballs trifft: das Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Kreativität, zwischen Struktur und Intuition.
Für die Bayern-Fans ist diese Saison mehr als eine Erfolgsstory. Sie ist eine Art Erlösung. Nach Jahren des Umbruchs, der Zweifel, der fast tragischen Momente – von Tuchels konfliktreichem Abgang bis zu der Suche nach einem neuen sportlichen Selbstverständnis – scheint der Verein wieder zu wissen, wer er ist. Nicht nur eine Maschine, die Titel produziert, sondern ein Organismus, der lebt, denkt, atmet. Der Rekord ist Symbol und Symptom zugleich: Symbol für eine Ära, die gerade beginnt, und Symptom einer Kultur, die sich erneuert hat.
In den Straßen von München wird darüber gesprochen, als handle es sich um eine Rückkehr zu alten Tugenden. „Mia san mia“ ist wieder mehr als ein Spruch auf einer Plakatwand – es ist eine Haltung, die sich in jedem Sprint, jedem Ballgewinn, jedem Tor widerspiegelt. Die Spieler tragen das Selbstbewusstsein wieder sichtbar, aber ohne Arroganz. Man sieht, dass sie Freude haben, Verantwortung zu übernehmen. Dass sie nicht nur für den Klub spielen, sondern füreinander. Es ist diese menschliche Komponente, die Kompanys Mannschaft besonders macht. Er versteht, dass Fußball mehr ist als Taktik – es ist Psychologie, Gemeinschaft, Vertrauen.
Natürlich gibt es auch Skeptiker. Manche sagen, die wahre Prüfung komme erst im Winter, wenn die Belastung steigt, die Verletzungen zunehmen, die Champions-League-Abende dichter werden. Und sie haben recht – kein Rekord gewinnt Titel, kein Lauf garantiert Erfolg im Mai. Doch wer den Fußball kennt, weiß, dass große Epochen oft mit genau solchen Momenten beginnen: mit einem Lauf, einer Serie, einem Gefühl der Unbesiegbarkeit. Der FC Bayern 2025/26 erinnert an jene Phasen, in denen man spürt, dass etwas in Bewegung geraten ist, das größer ist als die Summe seiner Teile.
In der Kabine, so berichten Insider, herrscht eine neue Kultur. Keine Hierarchien aus Eitelkeit, keine unnahbaren Stars, keine Grüppchenbildung. Kompany hat das Prinzip der „kollektiven Verantwortung“ eingeführt – jeder Spieler, ob Stammkraft oder Ergänzung, hat eine Stimme. Trainings werden mit ungewöhnlicher Präzision geplant, aber nie starr durchgeführt. „Er gibt uns einen Rahmen, aber füllt ihn mit Leben“, sagte einmal Leroy Sané über seinen Trainer. Es ist diese Balance, die Bayern stark macht: strukturiert, aber flexibel; ehrgeizig, aber menschlich.
Wenn man in die Gesichter der Spieler blickt, erkennt man jene seltene Mischung aus Fokus und Leichtigkeit, die nur Teams in außergewöhnlicher Form zeigen. Sie spielen, als wüssten sie, dass sie Teil von etwas Geschichtsträchtigem sind, ohne sich davon lähmen zu lassen. Und genau das unterscheidet sie von jenen Mannschaften, die an der Last der Erwartungen zerbrechen. Kompany hat es geschafft, Geschichte nicht als Bürde, sondern als Motivation zu vermitteln.
Vielleicht liegt darin die eigentliche Wiederholung der Geschichte – nicht im Rekord selbst, sondern im Geist dahinter. Wie Capellos Milan damals verkörpern Kompanys Bayern eine Idee vom Fußball, die über Ergebnisse hinausgeht. Eine Idee von Klarheit, von Verantwortung, von Schönheit in der Struktur. Die 13 Siege in Folge sind nur der sichtbare Teil eines Prozesses, der viel tiefer reicht: ein kultureller Wandel, ein neues Verständnis davon, wie man gewinnt, ohne sich selbst zu verlieren.
Ob diese Serie hält, ob sie gar ausgebaut wird, spielt fast keine Rolle. Denn das Entscheidende ist längst passiert: Bayern hat seine Identität zurückgefunden. In einer Zeit, in der Fußball oft von kurzfristigem Denken, von hektischen Trainerwechseln und flüchtigen Konzepten geprägt ist, wirkt das fast altmodisch – und gerade deshalb so revolutionär. Kompany hat bewiesen, dass man auch im Zeitalter der Daten, Algorithmen und Spielphilosophien den Kern des Spiels nicht vergessen darf: das Zusammenspiel von Herz, Kopf und Ball.
Und so schreibt sich die Geschichte weiter, leise und doch unaufhaltsam. In München, wo Legenden geboren und Erinnerungen konserviert werden, flackert wieder dieses alte Feuer. Die Menschen spüren, dass sie Zeugen eines neuen Kapitels sind. Dreizehn Spiele, dreizehn Siege – ein Echo aus der Vergangenheit, das in der Gegenwart widerhallt. Die Geschichte wiederholt sich – nicht, weil sie muss, sondern weil große Ideen im Fußball nie wirklich verschwinden. Sie warten nur auf den richtigen Moment, um wieder aufzuleuchten. Und diesmal trägt sie ein neues Gesicht, ein belgisches, mit einem ruhigen Lächeln und einer klaren Vision: Vincent Kompany.